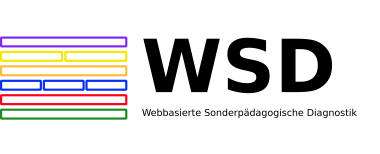wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Zeichnerische Gestaltungsverfahren
Zitiervorschlag: : Kopp, S. (2021). „Zeichnerische Gestaltungsverfahren“. Abgerufen von URL https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:verhalten:diagnverfahren:zeichngestv, CC BY-SA 4.0
Allgemeine Informationen
| Allgemeine Beschreibung | Zeichnerisches Gestalten bietet eine sehr gute Möglichkeit in angstfreier Atmosphäre Kontakt zum jungen Menschen jeden Alters aufzunehmen, zu interagieren und nonverbal zu kommunizieren. Dadurch ist es leichter, Emotionen auszudrücken und belastende Situationen darzustellen. Zeichnen kommt dem Ausdruckswillen von Kindern und auch Jugendlichen entgegen und regt so zu spontaner und kreativer Gestaltung an. |
|---|
| Ziele | Ziele sind individuell zu formulieren, da eine große Bandbreite an Themen bearbeitet werden kann. Erste Zielsetzungen des Diagnostikers können sein: - Einen Kontakt anbahnen, eine tragfähige Beziehung aufbauen, - Einen ersten Eindruck über psychomotorische Entwicklung und Kreativität gewinnen, - Einen ersten Eindruck über Formauffassung und Symbolisierungsfähigkeit gewinnen, - Interessensfelder und Themenfelder erkunden. - Gefühle und Ideen ausdrücken - Geeigneten Wortschatz aufbauen, Affekte regulieren - Einschneidende Erlebnisse bearbeiten - Umgang mit Krisen und Konflikten ermöglichen - Motivation und Selbstwertgefühl steigern - Eigene Ressourcen entdecken - Angemessene Interaktion und Kommunikation üben. |
|---|
| Diagnostischer Anwendungsbereich | Erforderlich für das Anwenden sind grundlegende Kenntnisse über die Entwicklung der zeichnerischen Kompetenzen und die Funktionen des Zeichnens sowie über die allgemeine diagnostische Bedeutung (LINK s.u.) zeichnerischer Gestaltungsverfahren. Zeichnerische Gestaltungsverfahren unterstützen die Bildung von Eingangs-Hypothesen unter anderem zur biografischen Entwicklung TF1, sowie zu Familiendynamik ( Themenfeld 2), Peerbeziehungen ( Themenfeld 7), Selbst ( Themenfeld 3) und individuelle Voraussetzungen ( Themenfeld 4). Es sind häufig erste Einsichten ohne viel Aufwand möglich. |
|---|
Hinweise zur Didaktisierung im Themenfeld biografische Entwicklung
| Spiel und psycho-dynamische Entwicklung | Die Entwicklung des kindlichen Spiels wird den Entwicklungsphasen der Libido zugeordnet. Die Entwicklung verläuft über das affektiv-motorische Interaktionsschema hin zu ersten Beziehungsspielen. Hier entstehen erste Symbolisierungen. Es erfolgt ein Wechsel zwischen aktiver und passiver Rolle. Danach erfolgt die Erweiterungen von der Dyade zur Triade, mittels Rollenspielen aus der Welt der Erwachsenen. Somit sind regressive und progressive Tendenzen gleichzeitig aktiv. Die letzte Phase ist geprägt von Regelspielen. Ziele hierbei sind: - Gegenseitige Verständigung um Absprachen, - Regeln, Verlässlichkeit, - Bindung an eine Gruppe von Gleichaltrigen - Auseinandersetzungen mit Leistungsanforderungen und Regeln - Gewissensbildung und stabile Identität |
|---|---|
| Funktion des kindlichen Spiels | - Spiel stellt vor der Sprache frühe Form der Verwendung von Symbolik und Kommunikation dar - Konstitutive Elemente (Oerter 2011) sind: Zweckfreiheit, Konstruktion neuer Realität, Ritualisierung - Durch Spiel möglich: Imagination, Phantasie und Kreativität und Entwicklung von Kognition - Spiel ermöglicht das Erleben von Selbstwirksamkeit und Erprobung von Rollen und Austesten von Grenzen, Erleben von Glück und Kontrolle - Spielen hat hohe Bedeutung für affektive Regulation bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen - Externalisierungen und Bewältigung einschneidender Erfahrungen in einem geschützten Rahmen - Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse möglich - Ausgleich eigener Mängel und Defizite - Steigerung des Selbstwertgefühls durch Identifikation mit starken Rollen - Identitätsverständnis in Bezug zu anderen: Verankerung in seiner personalen Umwelt - Für Jugendliche und Erwachsene bietet das Spielen eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Regression, Entspannung und Erholung von hohen kognitiven alltäglichen Anforderungen. |
| Allgemeine diagnostische Bedeutung | Unabhängig von der Zielstellung können folgende Aspekte in jeder Situation beobachtet werden, welche dann wiederum direkte Hinweise auf Bildungsangebote geben. Formale Aspekte - Kreativität, Farbenfreudigkeit, Sinn für Realität, Gestaltungsreichtum, Phantasie - Umgang mit dem Material - Flexibilität, Initiative, Energie, Unsicherheit, Temperament - Sensomotorische Kompetenzen - Entwicklungsstand und Reifegrad von Kognition, Affektkontrolle, Kohärenz von Denken, Fühlen und Handeln, Differenziertheit, Mentalisierungsfähigkeit, Konzentration, Symbolisierungsfähigkeit Inhaltliche Aspekte - Aktuelle Motive und Bedürfnisse (Bindung, Selbstwirksamkeit, Orientierung, Autonomie, Sicherheit, belastende Ereignisse, aktuelle Gefühlslage, aufgestaute Gefühle) - Befürchtungen, aktuelle Themen, Wünsche, Konflikte - Sprachliche Äußerungen |
> Themenfelder und Themen
> Gesamtübersicht diagnostische Verfahren
Layout und Gestaltung: Philipp Staubitz, Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Freiburg, Abtl. Sonderpädagogik
wsd/verhalten/diagnverfahren/zeichngestv.1639389051.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/12/13 10:50 von Philipp Staubitz