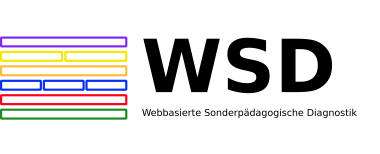Inhaltsverzeichnis
Stufenmodell der Partizipation nach Wright, Block und Unger
Zitiervorschlag: Gromer, B. (2024). „Stufenmodell der Partizipation nach Wright, Block und Unger“. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:theorien:partizipation, CC BY-SA 4.0
Partizipation vs. Teilhabe
Teilhabe und Partizipation werden in vielen Fällen als gleichbedeutend verstanden und verwendet. Dass das englische Wort „participation“ in der Originalfassung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in der deutschsprachigen Version mit „Teilhabe“ und „Teilnahme“ übersetzt wurde, trägt zu diesem Verständnis bei. Dennoch unterscheiden sich beide Begriffe qualitativ: Während „Teilhabe“ laut der World Health Organisation (WHO) das „Einbezogensein in eine Lebenssituation„ bedeutet, geht „Partizipation“ darüber hinaus. Partizipation bedeutet: Beteiligung von Menschen an Entscheidungsprozessen und Einflussnahme auf das Ergebnis.
„Ein Beispiel für Teilhabe ist, wenn Menschen mit Behinderungen barrierefrei ein Gebäude betreten können. Ein Beispiel für Partizipation ist, dass sie bei der Planung des Gebäudes mitentschieden haben. Es ist eben ein Unterschied, ob man im Nachhinein oder von Anderen in eine Lebenssituation einbezogen wird, oder ob man eine Lebenssituation von vorne herein selbst mitgestaltet.“ (ETUB, o.A.).
Stufenmodell der Partizipation
Das Stufenmodell der Partizipation (Wright/Block/Unger, 2007) zeigt auf, in welchen Formen Mitbestimmung ausgestaltet werden kann. Es ist anwendbar auf politische, gesellschaftliche, aber auch auf schulische bzw. unterrichtliche Prozesse.
Zitiervorschlag: „Stufen der Partizipation“ von Gromer, B. (2024) nach Wright/Block/Unger (2007). Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:theorien:partizipation|, CC BY-SA 4.0
1. Instrumentalisierung
Die selbstvertretenen Interessen, Wünsche und Belange der Zielgruppe werden außer Acht gelassen, Entscheidungen werden ohne die Zielgruppe getroffen. Die Entscheidungsträger rücken sich selbst in den Mittelpunkt, kommen aber selbst nicht aus der Zielgruppe. An Veranstaltungen nehmen Personen der Zielgruppe ggf. aus „dekorativen“ Gründen teil.
2. Erziehung und Behandeln
Die (Lebens-) Situation der Personen der Zielgruppe wird als defizitär wahrgenommen. Aufgrund dieser Defizite wird die Zielgruppe nicht für entscheidungsfähig gesehen. Professionelle versuchen die Defizite auszugleichen und Personen der Zielgruppe mit Anweisungen zu „richtigem“ Verhalten zu bringen.
3. Information
Die Entscheidungsträger:innen teilen der Zielgruppe mit, welche Probleme die Gruppe (aus Sicht der Entscheidungsträger:innen) hat und welche Hilfe sie benötigt: Grundlegende Informationen werden weitergegeben. Das Vorgehen der Entscheidungsträger:innen wird erklärt und begründet.
4. Anhörung
Die Sichtweise der Zielgruppe wird als bedeutsam erachtet. Personen der Zielgruppe werden zu bestimmten Themen angehört, können aber nicht beeinflussen, ob ihre Sichtweise auch Beachtung findet.
5. Einbeziehung
Die Zielgruppe nimmt formal an Entscheidungsprozessen teil. Ausgewählte Personen aus der Zielgruppe haben einen Sitz in Entscheidungsgremien. Die Teilnahme der Zielgruppe hat keinen verbindlichen Einfluss auf den Entscheidungsprozess.
6. Mitwirkung
Personen der Zielgruppe haben Mitspracherecht, jedoch keine alleinige Entscheidungsmacht. Die Entscheidungsträger:innen halten Rücksprache mit Vertreter:innen der Zielgruppe. Verhandlungen zwischen der Zielgruppenvertretung und den Entscheidungsträger:innen zu wichtigen Fragen sind denkbar.
7. Teilweise Entscheidungskompetenz
Die Zielgruppe wird auf der Grundlage eines Beteiligungsrecht ein Entscheidungsprozesse eingebunden. Auch wenn der Impuls zur Veränderung von außerhalb der Zielgruppe kommt werden innerhalb des Gesamtprozesse einzelne Entscheidungskompetenzen an die Vertreter:innen der Zielgruppe übertragen.
8. Entscheidungsmacht
Ein Vorhaben wird von Personen der Zielgruppe selbst initiiert und durchgeführt. Häufig entsteht die Eigeninitiative aus eigener Betroffenheit. Notwendige Entscheidungen trifft die Zielgruppe eigenständig und eigenverantwortlich. Die Maßnahme oder das Projekt wird jedoch von anderen außerhalb der Zielgruppe geleitet, begleitet und/oder betreut.
9. Selbstorganisation
Selbstorganisation geht über Entwicklungsprozesse der Partizipation hinaus. Die Verantwortung für ein Vorhaben liegt vollständig bei der Zielgruppe. Alle Entscheidungsträger kommen aus der Zielgruppe. Alle Aspekte der Planung und Durchführung werden von Menschen aus der Zielgruppe realisiert.
Literatur
ETUB - Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (o.A.). Partizipation. Abgerufen von URL: https://www.teilhabeberatung.de/woerterbuch/partizipation (14.10.2024)
Wright, M., Block, M., Unger, H. von (2007). Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung. In: Gesundheit Berlin (Hrsg.), 13. bundesweiter Kongress Armut und Gesundheit, Berlin 2007. Abgerufen von URL: https://www.armut-und-gesundheit.de/uploads/tx_gbbkongressarchiv/Wright__M..pdf (14.10.2024)
Wright, M. (2020). Partizipation: Mitentscheidung der Bürgerinnen und Bürger. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden. https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i084-2.0
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg