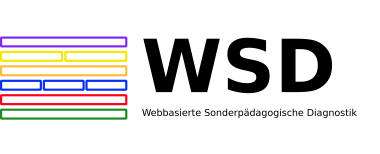Inhaltsverzeichnis
Empowerment-Konzept
Zitiervorschlag: Gromer, B. (2024). „Empowerment-Konzept“. Abgerufen von URL:. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:theorien:empowerment, CC BY-SA 4.0
Das Empowerment-Konzept ist historisch gesehen untrennbar mit den Bürgerrechtsbewegungen der 1950er Jahre in den USA sowie mit den Befreiungsbewegungen in den damals noch als „Dritte Welt-Länder“ bezeichneten Staaten, verbunden. Ausgrenzung, Diskriminierung, die Vorenthaltung von Rechten sowie Erfahrungen von sozialer Ohnmacht und Minderwertigkeit waren Kennzeichen dieser Bewegungen. Sie waren wegweisend für die Selbsthilfebewegungen und -vereine von Menschen mit Behinderungen (vgl. Lindmeier/ Meyer 2020, 39).
Je nach Perspektive kann Empowerment unterschiedlich verstanden werden:
1. Empowerment als Selbstermächtigung
Die betroffenen Personen lösen sich von Abhängigkeit und Bevormundung und erlangen durch eigene Initiative die Möglichkeit, aus ihrer Ohnmacht und Abhängigkeit herauszutreten. Sie entwickeln sich zu handelnden Personen, die für mehr Selbstbestimmung, Autonomie und Kontrolle über ihr Leben eintreten. Empowerment bedeutet in diesem Zusammenhang einen eigenständigen und selbstgesteuerten Weg zur Wiederherstellung von Selbstbestimmung und Partizipation im privaten und gesellschaftlichen Leben. Dieses Verständnis legt den Schwerpunkt auf Selbsthilfe und die selbstorganisierte Unterstützung durch die betroffenen Personen und ist vor allem in Projekten und Initiativen verankert, die in der Tradition der Bürgerrechtsbewegung und der Selbsthilfebewegung stehen. Es wird die gesellschaftspolitische Dimension von Empowerment herausgestellt.
2. Empowerment als professionelle Unterstützung von Selbstbestimmung, Autonomie und Partizipation
Nach der Übername des Empowerment-Konzepts in die pädagogische Praxis, kam es zu einer Bedeutungsverschiebung des Begriffs Empowerment. Hierbei wird nun der Fokus besonders auf die Unterstützung und Förderung der Selbstbestimmung durch professionelle Fachkräfte gelegt. Dabei wird die Rolle der Mitarbeiter:innen in psychosozialen oder pädagogischen Kontexten in den Blick genommen, die Prozesse begleiten und anstoßen, durch die Menschen ihre eigenen Gestaltungskräfte (wieder)entdecken, stärken und entfalten können. Die Fachkräfte stellen Ressourcen zur Verfügung, die Empowerment-Prozesse ermöglichen. Im Sinne dieser Perspektive versteht sich Empowerment als Ziel einer psychosozialen oder pädagogischen Praxis, die darauf abzielt, Menschen die Mittel an die Hand zu geben, um ihr Leben selbstverantwortlich zu gestalten. Gleichzeitig sollen Räume geschaffen werden, in denen sie ihre eigene Stärke erleben und solidarische Netzwerke aufbauen und erproben können (vgl. Meyer/ Lindmeier 2020, 39).
Empowerment im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Abhängigkeit
Das Empowerment-Konzept basiert auf einem dialektischen Grundgedanken: Menschen sind in der Regel in der Lage, ihr Leben ohne organisierte soziale Unterstützung zu gestalten. In marginalisierten Lebenslagen wird diese Fähigkeit jedoch durch fehlende oder stark eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten beeinträchtigt oder kann sich nicht entwickeln.
Psychosoziale oder pädagogische Maßnahmen, die zur Unterstützung von Menschen in Bedarfslagen entwickelt werden, unterstützen diese Menschen zwar, nehmen ihnen aber zugleich ihre Autonomie, machen sie abhängig und verstärken damit ihre Hilfsbedürftigkeit (vgl. Meyer/ Lindmeier 2021).
Hierbei wird das zentrale und als nicht auflösbar verstandene Grunddilemma deutlich, „[…], dass als intendierte Folge von Hilfe eben nicht das intendierte Empowerment, sondern eine gesteigerte Abhängigkeit von Hilfe entsteht“ (Lindmeier/ Meyer 2020, 40).
„Die Intention des Empowerment-Konzepts ist es hingegen, Menschen so zu unterstützen und zur Selbsthilfe anzuregen, dass sie power (Macht, Kraft) gewinnen und unabhängiger von Unterstützung werden“ (Meyer/ Lindmeier 2021). Empowerment agiert damit im Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, zwischen Autonomie und Abhängigkeit.
Folgende Aspekte können als Wertebasis für Empowerment herangezogen werden (vgl. Prilleltensky 1994, zitiert nach Lindmeier/ Meyer 2020, 41):
Autonomie und Selbstbestimmung
- Ziel ist nicht ein frei von Bindung und Abhängigkeiten agierendes Individuum, sondern meint die (Wieder-)Erlangung von Gestaltungsspielräumen im eigenen Leben, die es erlauben, bestehende soziale Abhängigkeiten anzuerkennen und in ihnen selbstwirksam und selbstbestimmt zu agieren.
Verteilungsgerechtigkeit
- Ressourcen und Lasten einer Gesellschaft müssen fair verteilt werden. Was „fair“ bedeutet ist Ergebnis immer wiederkehrender kritischer Überprüfung. Dieser Aspekt betont stark die politische Dimension des Empowerment-Konzepts.
Kollaborative und demokratische Partizipation
- Personen, die von Entscheidungen betroffen sind, werden in die Entscheidungsprozesse eingebunden und bekommen Mitbestimmungsmöglichkeiten zugesprochen.
Empowerment wendet sich also gegen paternalistisch-bevormundende Hilfe in einem „wohlfahrtsstaatlichen Bedürftigkeits- und Abhängigkeitsmodell“, ohne jedoch die Angewiesenheit auf soziale Beziehungen und Unterstützungen auszublenden. Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligungen mehr Kontrolle über das eigene Leben zu ermöglichen, darf nicht dazu führen, deren Bedürfnisse nach Hilfe und Unterstützung zu vernachlässigen (vgl. Lindmeier 2008 zitiert nach Lindmeier/ Meyer 2020, 40-41).
Literatur
ETUB - Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (o.A.). Partizipation. Abgerufen von URL: https://www.teilhabeberatung.de/woerterbuch/partizipation (14.10.2024)
Meyer, D./ Lindmeier, B. (2021). Empowerment als Pädagogisches Prinzip. Abgerufen von URL: https://www.bpb.de/lernen/inklusiv-politisch-bilden/335013/empowerment-als-paedagogisches-leitprinzip/ (11.11.2024)
Lindmeier, B./ Meyer, D. (2020). Empowerment, Selbstbestimmung, Teilhabe ‒ Politische Begriffe und ihre Bedeutung für die inklusive politische Bildung. In: Meyer, D./ Hilpert, W./ Lindmeier, B. (Hrsg.). Grundlagen und Praxis inklusiver politischer Bildung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 38 - 56.
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg