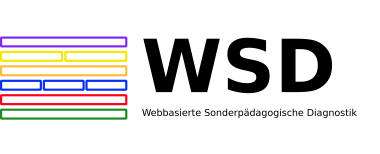Musterbildung und Wiederholungszwang
Zitiervorschlag: Gingelmaier, S. (2022). „Musterbildung und Wiederholungszwang“. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:wsd:verhalten:theorien_verhalten:musterbildung, CC BY-SA 4.0
| Kurzbeschreibung | Warum kommen Menschen schon als Kinder aus manchen Verhaltensspiralen nicht heraus? Die sich ähnelnden Theorien des Wiederholungszwangs (psychoanalytische Prägung), der Schemabildung (kognitiv-behaviorale Prägung) bzw. der Musterbildung (systemische Prägung) haben eine relativ hohe Überschneidungsmenge. Als Grundlage wird eine symbolische Re-Inszenierung von Traumata oder Traumafragmenten angenommen. Gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die schwieriges Verhalten zeigen, ist dieses Phänomen von elementarer Bedeutung. Zwei Zitate zur Erläuterung: „Das Ich, welches das Trauma passiv erlebt hat, wiederholt nun aktiv eine abgeschwächte Reproduktion desselben, in der Hoffnung, deren Ablauf selbsttätig leiten zu können.“ (Freud 1992, 110). „Der Wiederholungzwang beinhaltet, dass alte Formen des Erlebens und der Beziehungsgestaltung aufgrund innerer Notwendigkeit reproduziert werden. Im ungünstigsten Fall wiederholen sich belastende und leidvolle Erfahrungen immer wieder aufs Neue, mit Hilfe gleichbleibender Inszenierungen, die kein anderes Ergebnis zulassen – auch dann, wenn bewusst ein Veränderungswunsch besteht. Die innere Flexibilität kann aufgrund eines starken Wiederholungszwanges so gering sein, dass jeder Neubeginn verhindert wird. Das alte Unglück währt dann nahezu unverändert fort. Psychische Gesundheit zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass neue Erfahrungen zugelassen und psychisch integriert werden können“ (Ahrbeck 2008, 499). |
|---|---|
| Wie kann die Theorie beim Erklären von Verhalten helfen? | Die in gewisser Weise paradoxe Theorie besagt, dass (beziehungs-)traumatisierte Menschen jeden Alters auch in anderen, neuen Beziehungen dazu neigen, bekannte, wenig förderliche Beziehungskonstellationen (z.B. die des Täters und Opfers) unbewusst wiederherzustellen. Warum ist das so? Die Überlegungen vereinen zwei gegenläufige Tendenzen: Es kann das Ziel eines z.B. kindlichen Opfers sein, auf Bekanntes zurückgreifen zu wollen. So ist vorstellbar, dass die Rolle des Opfers eine derart identitätsstiftende Bedeutung für einen Menschen und sein Selbst einnehmen kann, dass die Leugnung dieses Zustands eine existenziellere Bedrohung darstellt, weil sich Selbstkonzept und -wert daran ausgerichtet haben. Überspitzt ließe sich dies so formulieren: „Lieber die Sicherheit haben, ein gequältes Opfer zu sein/zu bleiben, als vor dem Nichts zu stehen.“ Eine gegenläufige Ausformung des erfahrenen Leides kann die Übernahme der aggressiven Täterrolle sein: „Wenn ich mich mit dem Täter identifiziere und deswegen genauso Macht, Kontrolle und sogar Gewalt ausübe, muss ich mich nicht mehr klein und ohnmächtig fühlen.“ Natürlich sind nicht nur diese beiden Prototypen, sondern auch Mischformen zu finden und die Intensität der Ausprägung hängt von vielerlei Risiko- und Schutzfaktoren und dem Inhalt und der Schwere des Traumas ab. In beiden Richtungen bleibt der kindlichen Psyche aber die leidvolle Erfahrung des ohnmächtigen Angewiesenseins auf eine Fürsorgeperson, die durch psychische und emotionale Gewalt, Nicht-Verfügbarkeit oder einem ungesunden Übermaß an Nähe ein tiefes Misstrauen in Beziehungen und die soziale Welt pflanzt und Entwicklung hin zur psychischen Integration und Lernen verhindert. Diese belasteten und belastenden Muster des Beziehungsaufbaus und der Beziehungsführung werden auch in pädagogischen Organisationen und mit pädagogischen Fachkräften und Peers ausgetragen. |
| Grenzen | Dieses Konzept hat für Kinder und Jugendliche, die auffälliges Verhalten zeigen, sehr hohes Erklärungspotential. Trotzdem muss die Verbindung zur Traumatheorie gewahrt bleiben, damit es nicht unscharf und übergeneralisiert wird. |
| Diagnostische Fragen im Zusammenhang mit der Theorie | - Gibt es wiederkehrende Kommunikationsstrukturen, die als Muster erkennbar sind? - Wie beginnt eine musterhafte Inszenierung? - Wer bringt welche Affekte hinein, wie sehen mögliche Eskalationsstufen aus? - Wie lassen sich pädagogische Fachkräfte in solche Muster verwickeln? - Wie können sie den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit bieten, andere Kommunikationsstrukturen zu erfahren und auszuprobieren. |
| Konkrete diagnostische Methoden im Zusammenhang mit der Theorie | - Projektive Verfahren - Szenisches Verstehen - Freies Spiel - Musisch-ästhetischer Ausdruck |
| Impulse für die Gestaltung individueller Bildungsangebote | Akute Interventionen Kein Einlassen auf Machtkämpfe, pädagogisch aus einer reifen Position handeln. Kein Ausspielen von Machtüberlegenheit, keine Gegenaggression, Mahnung zur Einhaltung eines respektvollen Umgangs, trotz der wohl inszenierten und mitunter heftigen Situationen. Längerfristige Interventionen Beziehungsmuster sind stark erfahrungsbasiert und vor allem durch gegenläufige Beziehungserfahrungen veränderbar (vgl. Hoanzl & Weiß, 2010). Dies setzt Reflexion und den belastbaren Glauben an Veränderungs- und Entwicklungsfähigkeit von Seiten der pädagogischen Fachkräfte voraus - auch wenn diese oftmals nur in kleinsten Schritten und mit Rückschritten erfolgt. |
Literatur
Ahrbeck, B. (2008). Psychoanalytische Handlungskonzepte. In B. Gasteiger-Klicpera/ H. Julius & C. Klicpera, (Hrsg.): Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung. Handbuch der Sonderpädagogik Bd. 3 (497–507). Göttingen: Hogrefe.
Freud, S. (1992). Hemmung, Symptom und Angst. Berlin: Fischer.
Teile des Textes stammen aus: Gingelmaier, S. (2016). Schwierige Beziehungsdynamiken mentalisieren. Sonderpädagogische Förderung heute, 61, 203-216.:
Hoanzl, M. / Weiß, H. (2010): Frühförderung bei Kindern mit sozialen und emotionalen Belastungen. In: Ahrbeck, B. / Willmann, M. (Hrsg.): Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch. Stuttgart: Kohlhammer, 247–257.
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg