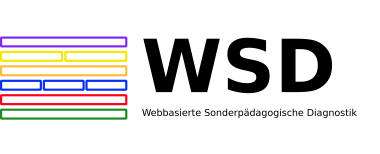Inhaltsverzeichnis
Persönliche Zukunftsplanung (person-centred planning)
Zitiervorschlag: Gromer, B. (2025). „Persönliche Zukunftsplanung (person-centred planning)“. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:theorien:zukunftsplanung
Als „Persönliche Zukunftsplanung“ werden methodische Planungsansätze verstanden, die zur selbstbestimmten Lebensplanung im Besonderen von Menschen mit Behinderung oder in anderer Weise unterstützungsbedürftiger Menschen eingesetzt werden. Ziel ist es, einer Person zu ermöglichen, „ […] über sich, ihre Träume, Wünsche und Ziele, ihre Werte, Stärken und Vorlieben und ihre wichtigen Menschen, Netzwerke und Lieblingsorte nachzudenken und eine Vorstellung für eine erstrebenswerte Zukunft zu bekommen“ (vgl. Doose 2020).
Ein zentrales Element ist dabei der sogenannte Unterstützer:innenkreis, der von der planenden Person selbst ausgewählt und zusammengestellt wird. Unterstützer:innenkreise können neben der planenden Person aus Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern sowie Professionellen zusammengesetzt sein (vgl. Doose 2023/ 2019).
Jede Persönliche Zukunftsplanung wird an den Wünschen, Themen, Lebenslagen, Voraussetzungen und Bedürfnissen der Person ausgerichtet und stellt diese als Akteur des eigenen Lebens in den Mittelpunkt aller Bestrebungen. Daher können Persönliche Zukunftsplanungen sowohl zeitlich, methodisch, als auch inhaltlich sehr unterschiedliche gestaltet sein. Die Persönliche Zukunftsplanung richtet den Blick bewusst auf die Stärken, Interessen und Ressourcen, in besonderem Maße auf die Wünsche und Träume einer Person, als Ausgangspunkt eines Veränderungs- und Entwicklungsprozesses. Zudem nimmt die Persönliche Zukunftsplanung Veränderungen des Kontextes und den Abbau von bestehenden Barrieren in den Blick, um mehr Selbstbestimmung, Partizipation und Lebensqualität zu erreichen (vgl. Doose 2020).
Die Persönliche Zukunftsplanung berücksichtigt drei grundlegende Handlungsorientierungen (vgl. Doose, 2023/2019, 3f.):
- Personen-Orientierung: Die Art und Weise wie Persönliche Zukunftsplanungen gedacht und ausgestaltet werden, stellt die planende Person als Hauptperson in den Mittelpunkt und macht diese zum handelnden Akteur des eigenen Lebens. Die Person hat bei Dingen, die ihr eigenes Leben betreffen, Mitgestaltungsmöglichkeit und Entscheidungsmacht.
Eine Persönliche Zukunftsplanung nimmt ebenfalls konkrete Personen im Umfeld der betroffenen Person mit in den Blick, um Ziele zu erreichen und um Partizipation zu ermöglichen.
- Sozialraum-Orientierung: Sozialraum-Orientierung bedeutet, Möglichkeiten vor Ort zu entdecken oder zu entwickeln, an denen die Person ihre Fähigkeiten einbringen kann und den Ort zu einem besseren Ort für alle Bürger:innen macht. Das Konzept der Sozialraumorientierung ist damit ein wesentlicher Gelingensfaktor für inklusives Denken und Handeln.
- Beziehungs-Orientierung: Soziale Beziehung als anthropologisches Grundbedürfnis sind eine tragende Kraft im Prozess der Zukunftsplanung und stellen die wichtigste Ressource für eine Person dar.
Der Unterstützer:innenkreis in der Persönlichen Zukunftsplanung stellt eine Möglichkeit dar, Beziehungen zu würdigen, zu reaktivieren, zu stärken und zu nutzen. Die kreativen Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung ermöglichen ein tieferes, gegenseitiges Kennenlernen und gemeinsames Erkunden sowie solidarisches Handeln. Sie sind in diesem Sinne Zutaten einer anderen Unterstützungskultur. Das „Thema“ einer Person wird zum gemeinsamen Vorhaben vieler.
Für eine Persönliche Zukunftsplanung im Unterstützer:innenkreis stehen verschiedene Planungsformate zur Verfügung, die jeweils moderiert und visualisiert werden. Drei Methoden werden hier exemplarisch vorgestellt:
1) Persönliche Lagebesprechung
Die Persönliche Lagebesprechung besteht aus neun Fragestellungen, zu denen Antworten auf jeweils einem Plakaten zusammengetragen werden. Diese Plakate werden im Raum ausgestellt. Die Lagebesprechung dauert mindestens anderthalb bis zwei Stunden. Steht diese Zeit nicht zur Verfügung, kann man auch eine kürzere Version mit nur sechs Fragen wählen. Mit dieser Version kann man herausfinden, was zurzeit gut läuft und was nicht, und anschließend die verschiedenen Perspektiven aufzeigen. Sie dauert mindestens eine Stunde (vgl. Sanderson/ Mathiesen 2003 zitiert nach Doose 2020).
Die Lagebesprechung wird in drei Phasen unterteilt:
| Phase | Plakatnummer | Fragestellung |
|---|---|---|
| Ankommen und orientieren | 1 | „Wer ist da?“ |
| 2 | „Gesprächsregeln“ | |
| 3 | „Was wir an … (Name) schätzen und mögen“ | |
| Ideen zusammentragen | 4 | „Was läuft gut?“ „Was läuft nicht gut?“ |
| 5 | „Offene Fragen – Probleme, die gelöst werden müssen“ | |
| 6 | „Was ist … (Name) jetzt wichtig?“ | |
| 7 | „Was ist … (Name) in Zukunft wichtig?“ | |
| 8 | „Was braucht … (Name), um gesund und sicher zu sein?“ | |
| Aktionsplan erstellen | 9 | „Aktionsplan“ |
Zitiervorschlag: „Tabelle Phasen und Fragestellungen der Persönlichen Lagebesprechung nach Sanderson & Mathiesen (2003)“ von Gromer, B. (2025) zitiert nach Doose (2020).
2) MAPS
Bei MAPS (ursprünglich für „Making Action Plans“; dt. Handlungspläne entwickeln) handelt es sich ebenfalls um ein personenzentriertes Planungsverfahren. MAPS unterstützt dabei, gemeinsam mit der betroffenen Person (z. B. ein junger Mensch mit Unterstützungsbedarf), der Familie und einem Unterstützer:innenkreis eine lebensnahe und motivierende Zukunftsvision zu entwickeln.
MAPS basiert auf einer strukturierten Moderation mit einer festen Abfolge von Fragen, die gemeinsam erörtert und visuell dokumentiert werden. Die Durchführung von MAPS dauert mindestens zweieinhalb Stunden bis einen halben Tag (vgl. Forrest & Pearpoint in O’Brien et al. 2010 zitiert nach Doose 2020).
Die Handlungsschritte sind (vgl. Doose 2020, 190-192):
| Schritt | Bezeichnung | Inhalt |
|---|---|---|
| 1 | „Die Geschichte“ | Drei Geschichten aus dem Leben der Person, die mit der aktuellen Veränderung in Zusammenhang stehen, werden erzählt und anschließend nach den Vorstellungen der Person visualisiert. |
| 2 | „Der Traum“ | Die planende Person schildert, wie ihr persönlicher Traum aussieht. „Was ist mein Traum? Was möchte ich wirklich im Leben?“ Diese Vision wird ebenfalls visualisiert. |
| 3 | „Der Albtraum“ | Der Albtraum steht für die schlimmste Möglichkeit, die für die planende Person eintreten könnte. Auch der Albtraum wird nach den Vorstellungen der Person visualisiert aber im Gespräch nicht weiter vertieft. |
| 4 | „Die Gaben“ | Der Unterstützer:innenkreis formuliert die Stärken und Fähigkeiten der Person. Schlüsselbegriffe werden notiert und im Anschluss mit einem passenden Bild visualisiert. |
| 5 | „Was braucht es?“ | Es geht darum herauszufinden, welche Bedingungen notwendig sind, damit die planende Person ihre „Gaben“ bestmöglich und gewinnbringend für andere einbringen kann. |
| 6 | „Der Aktionsplan“ | Die notwendigen nächsten Handlungsschritte werden gemeinsam entwickelt: - Möglichkeiten, nach denen gesucht werden soll, - Veränderungen, die ausgehandelt werden müssen, - Menschen, die informiert und einbezogen werden müssen. Die Ideen werden notiert. Die planende Person und der Unterstützer:innenkreis entscheiden, welche zwei bis drei Aktionen ganz besonders wichtig für das weitere Vorankommen sind. Es werden auf Wunsch der Person zu diesen Punkten konkrete Schritte geplant. Dann wird festgelegt, wer was bis wann macht. |
Zitiervorschlag: Tabelle MAPS-Handlungsschritte von Gromer, B. (2025) in Anlehnung an Doose (2020).
3) PATH
PATH (ursprünglich „Planning Alternative Tomorrows with Hope“; dt. „Ein anderes Morgen mit Hoffnung planen“) ist ein Planungsverfahren, das insgesamt acht Schritte umfasst. Alle besprochenen Schritte werden auf einem sehr großen Plakat dokumentiert und visualisiert. Da das Verfahren sehr umfassend ist, sollte eine Person, die mit der Methode gut vertraut ist, die Moderation des Prozesses übernehmen (vgl. O‘Brien, Pearpoint & Forrest 2010 zitiert nach Doose 2020).
Zitiervorschlag: „Grafik PATH-Prozess nach O‘Brien, Pearpoint & Forrest 2010“ von Gromer, B. (2025) in Anlehnung an Doose (2020).
Der Planungsprozess startet nach der Begrüßung mit dem Finden des „persönlichen Nordsterns“ (1). Der „persönliche Nordstern“ steht stellvertretend für das, was die Hauptperson im Leben leitet, ihre Werte, Ziele und Ideale. Dieser Schritt soll dem Unterstützer:innenkreis ermöglichen zu verstehen, was der planenden Person in ihrem Leben wichtig ist (vgl. Doose 2020, 193).
Die „Zukunftsvision“ (2) soll ein positives, lebendiges Bild von den Möglichkeiten zu entwerfen, die die Person zusammen mit ihrem Unterstützer:innenkreis in den nächsten ein bis zwei Jahren schaffen kann. Dazu reisen die Beteiligten gedanklich mit einer Zeitmaschine in die Zukunft und beschreiben, wie sich das Leben der planenden Person nach der gemeinsamen Intervention verändert und weiterentwickelt hat (vgl. Doose 2020, 194).
Im Anschluss wird die aktuelle Lebenssituation beschrieben (3) und ggf. mit einer Metapher oder einem passenden Bild visualisiert.
Die Persönliche Zukunftsplanung hat als Grundannahme, dass für Veränderungsprozesse das Mitwirken mehrerer Personen in einem persönlichen Netzwerk notwendig ist. Daher werden im nächsten MAPS-Schritt Unterstützer:innen für die entwickelte Vision gesucht (4). Die anwesenden Personen können sich entscheiden, ob sie sich aktiv am Erreichen der positiven Zukunft für die planende Person beteiligen möchten. Ggf. werden noch weitere nicht anwesende Personen identifiziert, die den Unterstützer:innenkreis erweitern könnten (vgl. Doose 2020, 194).
Es folgt ein kurzes Brainstorming (5), welche Kompetenzen und Ressourcen bereits vorhanden sind und was zusätzlich gebraucht wird (vgl. Doose, 2020, 195):
- Menschen und Beziehungen: „Wen kennen wir?“
- Organisationen, Vereine und Gruppen: „Wo gehören wir dazu? Wo sind wir Mitglied?“
- Know-How: „Welche Informationen, Kenntnisse und Fertigkeiten haben wir?“
- System und Netzwerk: „Was können die vorhandenen Systeme für uns tun? Welche Rechtsansprüche bestehen?“
- Eigene Energie und Gesundheit: „Was können wir für uns tun?“
Es werden nun Meilensteine definiert (6), die wesentlich für das Erreichen der Zielperspektive sind und nach etwa der Hälfte der angedachten Gesamtzeit erreicht sein sollen.
In den Schritten (7) und (8) wird der anstehende Zeitraum geplant, Aufgaben verteilt und Verantwortlichkeiten geklärt. Dabei geht es um kleine kurzfristige Aufgaben und Ziele (innerhalb der nächsten 24 bis 72 Stunden) und mittelfristigen Aufgaben für die kommenden Wochen. Die Personen des Unterstützer:innenkreises machen Vorschläge für Aufgaben, die sie übernehmen können und die planende Person entscheidet, welche Angebote sie annehmen möchte (vgl. Doose 2020, 195).
Literatur
Doose, S. (2020). „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung weiter gedacht. Neue Perspektiven einer personenorientierten Planung mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Neu-Ulm: AG SPAK. Textteil online verfügbar in der digitalen Bibliothek bidok – behinderung inklusion dokumentation seit 2020, 265 Seiten, URN urn:nbn:at:at-ubi:bidok:3-2457.
Doose, S. (2023/2019). Persönliche Zukunftsplanung – ein gutes, passendes Leben in Verbundenheit gestalten. Original erschienen 2019 in: Teilhabe, 4, 176–180. Online verfügbar in der digitalen Bibliothek bidok – behinderung inklusion dokumentation seit 2023, 12 Seiten, URN: urn:nbn:at:at-ubi:bidok:3-2499.
O’Brien, J., Pearpoint; J., & Kahn, L. (2010). The PATH & MAPS Handbook. Person-Centred Ways to Build Community. Toronto: Inclusion Press.
Sanderson, H. & Mathiesen, R. (2003). Person Centred Reviews. URL: https://www.academia.edu/26424346/Person_Centred_Reviews (15.05.2025)
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg