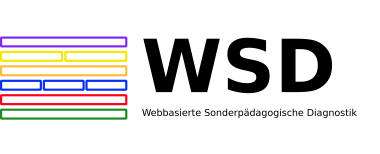Inhaltsverzeichnis
Lebensqualitätskonzept nach Seifert
Zitiervorschlag: Gromer, B. (2024). „Lebensqualitätskonzept nach Seifert“. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:theorien:lebensqualitaet, CC BY-SA 4.0
Aspekte des Lebensqualitätskonzepts
Das Konzept Lebensqualität verbindet die objektive Perspektive der Lebensbedingungen und die subjektiv wahrgenommene Perspektive der Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation. Das Konzept der Lebensqualität kann als moderne Leitidee für die Beschreibung und gesellschaftliche Gestaltung von Lebensverhältnissen verstanden werden (vgl. Zentel 2022, 27).
Auf der Grundlage des Quality of Life (QoL)-Modells von Schalock & Verdugo (2002) entstand das folgende Lebensqualitätskonzept von Seifert (2009):
Zitiervorschlag: Grafik „Modell der Lebensqualität nach Seifert (2009)“ von Gromer, B. (2024) in Anlehnung an Lamers, Musenberg & Sansour (2021). Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:theorien:lebensqualitaet|, CC BY-SA 4.0
Die acht Kernbereiche der Lebensqualität sind eingeordnet in drei Systemebenen (vgl. Zentel 2022; Lamers, Musenberg & Sansour 2021):
- Personbezogenes Wohlbefinden → Mikroebene (individuell)
- Entwicklung und Aktivität → Mesoebene (organisatorisch)
- Soziale und gesellschaftliche Teilhabe → Makroebene (gesellschaftlich)
Personbezogenes Wohlbefinden umfasst das körperliche, das emotionale und materielle Wohlbefinden. Diese drei Kernbereiche umfassen:
- körperlich: z.B. den Gesundheitszustand und die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper, die Ernährung und die Qualität der (Körper-) Pflege, Aspekte der Mobilität
- emotional: z.B. das Stress- und Belastungserleben bzw. Copingstrategien und Resilienzfaktoren, Selbstbild und Selbstwertgefühl sowie die Anerkennung als Person.
- materiell: z.B. die Wohnsituation, Hilfsmittel, persönliches Eigentum und die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.
Entwicklung und Aktivität meint die Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung, z.B.:
- Möglichkeiten zur Nutzung von Bildungsangeboten und Erlangung von Bildungsabschlüssen,
- Möglichkeiten einer sinnstiftenden Arbeit oder Beschäftigung nachzugehen,
- Möglichkeiten, die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln,
- Möglichkeiten den Alltag zu bewältigen.
Der Aspekt der Selbstbestimmung hat für diesen Bereich eine große Bedeutung, z.B. inwiefern eine Person Einfluss auf die Gestaltung ihres Lebens nehmen kann.
Soziale und gesellschaftliche Teilhabe umfasst die Kernbereiche zwischenmenschlicher Beziehungen, das Eingebundensein in die Gesellschaft sowie die Zusprache und Einhaltung von Rechten:
- zwischenmenschliche Beziehungen: z.B. Möglichkeiten zur Kommunikation, Erfahrungen von Zugehörigkeit und Anerkennung in der Beziehung zu anderen Menschen.
- soziale Inklusion: Teilhabemöglichkeiten einer Person in den verschiedenen Lebensbereichen, z.B. als Kund:in im Supermarkt, als Nutzer:in von kulturellen Angeboten, als Nutzer:in von Freizeitangeboten etc.
- Anerkennung und Absicherung von Rechten: z.B. Leistungen aus dem Bundesteilhabegesetz, das Recht auf Partizipation, Privatsphäre oder Barrierefreiheit, die Wahrung der Menschenwürde.
Die Lebensqualität ist somit zum einen von den objektiven Lebensumständen, zum anderen von der subjektiven Bewertung dieser Lebensumstände durch die betroffene Person abhängig.
Tab.1: Wohlfahrtspositionen nach Zapf (1984) aus Zentel (2022)
Well-Being, wenn sowohl die objektiven Lebensbedingungen als auch das subjektive Wohlbefinden als gut eingeschätzt werden, stellt die Zielperspektive aller Anstrengungen um Lebensqualität dar. Der Gegenpol hierzu wäre ein Zustand der Deprivation, in dem beides als schlecht bewertet wird. Als paradoxe Widersprüche können Dissonanz und Adaption gesehen werden, wenn bei guten Lebensbedingungen das subjektive Wohlbefinden als schlecht bewertet wird, bzw. bei objektiv schlechten Lebensbedingungen eine positive Bewertung der eigenen Zufriedenheit vorgenommen wird (vgl. Zentel 2022, 27-28). Gerade letzteres, auch als Zufriedenheitsparadoxon bezeichnet, ist im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung häufiger zu beobachten. Ein Grund dafür könnte in den Erwartungen liegen, die eine Person an ihre Lebensumstände vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Lebenserfahrungen entwickelt hat. Möglicherweise hatte sie bislang keine Gelegenheit, andere Lebensbedingungen oder Angebote kennenzulernen (vgl. Lamers, Musenberg & Sansour 2021, 229).
Erhebung von diagnostischen Daten zur Lebensqualität im Kontext Sonderpädagogik
Mittlerweile stehen eine Anzahl an Verfahren zur Erhebung der Lebensqualität (Link zu den Testbeschreibungen) zur Verfügung, die auch in sonderpädagogischen Handlungsfeldern eingesetzt werden können. Allerdings bleibt die Messbarkeit besonders im Kontext Sonderpädagogik weiterhin schwierig, auch wenn international größtenteils Einigkeit über die Dimensionen und Kriterien von Lebensqualität besteht.
Bei der Bestimmung von Lebensqualität werden, wie beschrieben, sowohl objektive Kriterien als auch die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der jeweiligen Person einbezogen.
Dies kann im Kontext der Sonderpädagogik eine große Herausforderung darstellen: Es kann vorkommen, dass die Bewertung der Lebensqualität durch die betroffene Person z.B. aufgrund kommunikativer Schwierigkeiten oder eingeschränkter Introspektionsfähigkeit nicht eindeutig erfasst werden kann. In diesem und auch anderen Fällen wird auf eine stellvertretende Einschätzung durch andere Personen, z.B. durch Angehörige oder Mitarbeiter:innen, zurückgegriffen.
Dabei muss reflektiert werden, inwieweit dabei auch die Vorstellungen und Wünsche dieser Personen mit in ihre Einschätzung einfließen bzw. inwieweit tatsächlich eine Annäherung an die Perspektive der Person für die stellvertretend Auskunft gegeben wird, möglich ist. Systematische, mehrperspektivische und kriteriengeleitete Beobachtungen und Einschätzungen durch mehrere Personen über einen längeren Zeitraum können diesen Prozess unterstützen. Jedoch ist das subjektive Erleben einer Person nur begrenzt beobachtbar (vgl. Lamers, Musenberg & Sansour 2021, 237; Schwartze 2022, 52).
Die Erfassung der Lebensqualität im Kontext Sonderpädagogik, im besonderen bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, hat auch methodologische Schwierigkeiten. Bei Interviewmethoden kann u.a. die Befragung durch die befragte Person selbst (z.B. durch sozial erwünschte Antworten), durch die gestellten Fragen (z.B. durch die Formulierung) oder die Interviewer:in und die Befragungssituation (z.B. Beziehung, Alter, Geschlecht, Ablenkung) gestört werden (vgl. Schwartze 2022, 52).
Das Lebensqualitätskonzept im Zusammenhang mit vorschulischen, schulischen und nachschulischen Angeboten
Durch die Berücksichtigung der verschiedenen Dimensionen von Lebensqualität ergeben sich im vorschulischen, schulischen und nachschulischen Kontext vielfältige Chancen (vgl. Beck 1998 nach Lamers, Musenberg & Sansour 2021):
- Das Konzept der Lebensqualität regt dazu an, die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Mittelpunkt zu stellen, nicht die Bedingungen, die die Umwelt vorgibt. So können die Rahmenbedingungen und auch die Angebote an Arbeits- und Bildungsorten aus dem Blickwinkel der Zielgruppe und vor dem Hintergrund ihrer Lebensqualität kritisch hinterfragt werden.
- Bildungsangebote können aktiv zur Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen beitragen, indem sie z. B. ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen, sinnvolle und sinnstiftende Aktivitäten ermöglichen, die zur individuellen Weiterentwicklung anregen, Selbstbestimmung unterstützen und soziales Wohlbefinden und gesellschaftliche Partizipation fördern.
- Das Konzept der Lebensqualität schafft Anhaltspunkte für die Planung und Evaluation von Bildungsangeboten (z.B. im Lebensfeld „Selbstständiges Leben“). Die verschiedenen Aspekte, die Lebensqualität umfassen, können genutzt werden, um die Lebensqualität von einzelnen Personen differenzierter einzuschätzen und Überlegungen anzustellen, wie ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele in den verschiedenen Bereichen noch besser beachtet werden können.
Literatur
Beck, I. (1998). Das Konzept der Lebensqualität: eine Perspektive für Theorie und Praxis der Hilfen für Menschen mit einer geistigen Behinderung. In: Jakobs, H.; König, A. & Theunissen, G. (Hgg.): Lebensräume – Lebensperspektiven. Ausgewählte Beiträge zur Situation Erwachsener mit geistiger Behinderung. Butzbach-Griedel: Verlag – Afra, 348–388.
Lamers,W.; Musenberg, O. & Sansour, S. (Hgg.) (2021). Qualitätsoffensive - Teilhabe von erwachsenen Menschen mit schwerer Behinderung. Grundlagen für die Arbeit in Praxis, Aus- und Weiterbildung. Bielefeld: Athena.
Schalock, R.L.; Verdugo, M.A. (2002). Handbook on Quality of Life for Human Service Practitioners. Washington D.C.: American Association on Mental Retardition.
Schwartze, M. (2022). Diagnostische Annäherungen an Lebensqualität. In: Zentel, P. (Hg.). Lebensqualität und geistige Behinderung. Theorien, Diagnostik, Konzepte. Stuttgart: Kohlhammer, 44-54.
Seifert, M. (2009). Lebensqualität von Menschen mit schweren Behinderungen Forschungsmethodischer Zugang und Forschungsergebnisse. Zeitschrift für Inklusion, 1(2) https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/186
Zentel, P. (2022). Lebensqualität oder die Qualität des Lebens. In: Zentel, P. (Hg.). Lebensqualität und geistige Behinderung. Theorien, Diagnostik, Konzepte. Stuttgart: Kohlhammer, 21-43.
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg