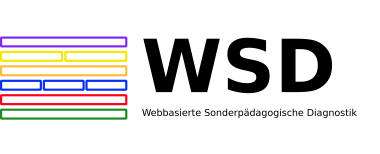Inhaltsverzeichnis
Frühkindliche Entwicklung von Motorik und Bewegung
Zitiervorschlag: Gromer, B. (2025). „Frühkindliche Entwicklung von Motorik und Bewegung.“ Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:theorien_bewegung:entwicklung
Pränatale motorische Entwicklung
Die motorische Entwicklung eines Kindes beginnt nicht erst mit der Geburt, sondern bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft, pränatal im Mutterleib. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über vorgeburtliche Bewegungsmuster und -formen und deren motorische Funktionen (vgl. Largo 2017; Rosenkötter 2013).
| Altersbereich | Bewegungsmuster und -formen | Motorische Funktionen |
|---|---|---|
| ca. 8. SSW | Erste Bewegungen sind im Ultraschall beobachtbar. | |
| ab ca. 10. SSW | Vielzahl von Bewegungsformen entwickeln sich: - Arm- und Beinbewegungen - Drehen des Kopfes - Hand-Hand-Berührungen - Hand-Gesicht-Berührungen - Atembewegungen - Mund öffnen - Steck- und Beugebewegungen - Gähnen - Schlucken - an Fingern saugen/lutschen | - Einüben von (überlebenswichtigen) Bewegungsmustern. - Einüben von Organfunktionen für nachgeburtliche Aufgaben. - Modellierung der Gliedmaßen/Ausbildung von Knochen, Gelenken und Muskeln. - Einstellen in den Geburtskanal. |
| ca. 14. SSW | Alle Bewegungsmuster, die auch postnatal zu beobachten sind, sind angelegt und differenzieren sich aus. | |
| ca. 16.- 22. SSW | Bewegungen des Kindes sind durch die Mutter spürbar. Später dann auch von außen fühl-/ bzw. sichtbar. | |
| bis zur Geburt | Mit zunehmender Größe des Fötus nehmen die Bewegungsmöglichkeiten im Mutterleib wieder ab. |
Variabilität der motorischen Entwicklung
Fortbewegungsart und Zeitpunkt der motorischen Entwicklung sind von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Aktuelle Forschungen lassen den Schluss zu, dass kein Entwicklungsmerkmal bei gleichaltrigen Kindern gleich ausgeprägt ist. Der intra- und interindividuelle Entwicklungsverlauf eines Kindes entspricht daher keiner konstanten Entwicklungskurve (vgl. Largo 2017; Michaelis et al. 1993; Rosenkötter 2013; Pickler & Tardos 2018).
Normvorstellungen der (motorischen) Entwicklung sind aufgrund der bestehenden Variabilität teilweise irreführend, zumindest immer kritisch zu hinterfragen. „Die Vielfalt in ihrem ganzen Ausmaß zu kennen und als biologische Realität zu akzeptieren, ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, den individuellen Bedürfnissen und Eigenschaften des Kindes gerecht zu werden“ (Largo o. A.).
Unterschiedliche Entwicklungsstadien können gleichzeitig nebeneinander bestehen, greifen ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. Immer wieder treten Entwicklungsschwerpunkte in einem Entwicklungsbereich auf. Die Entwicklung in anderen Bereichen kann dabei ggf. stagnieren oder auch kurzfristig Rückschritte machen.
Zitiervorschlag: Grafik „Variabilität des zeitlichen Auftretens motorischer Entwicklungsschritte nach Largo (2017)“ von Gromer, B. (2025). Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:theorien_bewegung:entwicklung, CC BY-SA 4.0
Die motorische Entwicklung der ersten Lebensjahre ist stark geprägt durch Reifungsprozesse. Diese Prozesse sind genetisch determiniert, folgen einem festgelegten Reifungsprogramm, regulieren sich weitgehend selbst und verlaufen nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass die eigene Aktivität des Kindes und Kontextfaktoren unter denen ein Kind aufwächst, ohne Bedeutung für die motorische Entwicklung sind (vgl. Leyendecker 2005). Das folgende Modell stellt diese Zusammenhänge dar:
Zitiervorschlag: Grafik „Adaptiv-epigenetisches Entwicklungsmodell nach Michaelis et al. (1993)“ von Gromer, B. (2025) in Anlehnung an Leyendecker (2005). Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:theorien_bewegung:entwicklung, CC BY-SA 4.0
Motorische Entwicklung der ersten Lebensjahre
Großmotorik
Die Großmotorik (häufig auch als Grobmotorik bezeichnet) umfasst die Koordination der Bewegung und Haltung von Rumpf und Extremitäten unter Beteiligung der großen Muskelgruppen.
| Altersbereich | Entwicklung |
|---|---|
| ~0 bis 3 Monate | - Das motorisches Verhalten ist geprägt durch eine Vielzahl verschiedener Reflexreaktionen, sowie… - … (noch) ungezielten häufig symmetrischen Arm- und Beinbewegungen (Strampeln). - Die Kopfkontrolle entwickelt sich langsam. Ab etwa dem 3. Lebensmonat auch in unterstützer Sitzhaltung und Bauchlage. |
| ~4 bis 9 Monate | - Nach dem 3. bis 6. Lebensmonat sind die meisten Neugeborenen-Reflexe gehemmt. - Symmetrische Haltungsformen in „tiefen“ Positionen (z.B. Unterarm- oder Handwurzelstütz in Bauchlage) werden zu Gunsten asymmetrischer Formen (z.B. Einarm-Seitstütz) aufgelöst. - Das Kind verfügt über eine stabile Kopfkontrolle in unterschiedlichen Positionen. - Das Kind entwickelt erste Formen der Fortbewegung und wird mobil (z.B. drehen, robben, krabbeln, schieben, aufsitzen). - Der Zeitpunkt und die Form der Fortbewegung variieren stark. - „Mittlere“ Positionen (Vierfüßlerstand, Sitz) werden auf unterschiedliche Weise erreicht. - Die gewonnenen Fähigkeiten in der Motorik bieten im Zusammenspiel mit weiteren Entwicklungsbereichen neue Möglichkeiten, die Umwelt zu entdecken, zu erfahren und zu begreifen. |
| ~10 bis 24 Monate | - Kinder bewegen sich nun in unterschiedlicher Weise fort. - Es besteht keine festgelegte Reihenfolge bestimmter, aufeinander folgender Fortbewegungsarten. - Es werden „hohe“ Positionen (aufstehen, Stand, gehen) erreicht. - Umwelterfahrung sind nun auch selbstständig im vertikalen Raum möglich. - Der Zeitpunkt des Auftretens verschiedener Entwicklungsstadien variiert stark. |
| ~25 bis 48 Monate | - Nach dem 2. Lebensjahr besteht die motorische Entwicklung im Besonderen aus der Differenzierung der Motorik im Hinblick auf Koordination, Gleichgewicht und Kraft sowie der Anpassung der motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten an die Erfordernisse der Umwelt. - Kinder werden mit unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln mobil. - Die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind bei gleichaltrigen Kindern sehr unterschiedlich weit entwickelt. - Das Umfeld hat großen Einfluss darauf, ob Kinder ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachkommen können, indem Angebote zur Weiterentwicklung der motorischen Fähigkeiten und Aneignung motorischer Fertigkeiten gemacht werden. |
(vgl. Largo 2017, Michaelis et al. 2013; Rosenkötter 2013; Pickler & Tardos 2018)
Variabilität der Lokomotion
Studien zur Entwicklung der kindlichen Fortbewegung (Largo 2017; Pickler & Tardos 2018) zeigen die Vielfältigkeit der lokomotorischen Entwicklung. 87% aller untersuchten Kinder zeigen einen Entwicklungsprozess vom Drehen auf Bauch und Rücken, Kreisrutschen, Robben auf dem Bauch und auf den Knien, Krabbeln über den Bären- bzw. Vierfüßlerstand zum Aufstehen und dann zum freien Gehen (vgl. Largo 2017). Immerhin 13% der beobachteten Kinder zeigen ein verändertes Entwicklungsverhalten. Einige Kinder lassen einige Fortbewegungsformen aus oder bewegen sich beispielsweise nie auf allen vieren fort. Es werden auch Kinder beschrieben, die weder krabbeln noch robben, sich aber z.B. durch Aufsitzen und Rutschen fortbewegen. Weitere eher seltene und ungewöhnliche Fortbewegungsarten sind das Rollen, das Schlängeln und die sog. „Brücke“. Im Gegensatz zu früheren Annahmen wird die beschriebene Vielfalt heute als „normale“ Entwicklung gesehen, die nicht zwangsläufig bei Ausbleiben einer Bewegungsform zu einer physiotherapeutische Behandlung führt (vgl. Largo 2017; Stemme et al. 2012).
Besonders groß ist die Variabilität des Zeitpunkts beim Laufenlernen, wie folgende Grafik verdeutlicht:
Zitiervorschlag: Grafik „Zeitpunkt des Laufenlernens nach Largo (2017)“ von Gromer, B. (2025). Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:wsd:selbststaendiges_leben:themenfeld:theorien_bewegung:entwicklung, CC BY-SA 4.0
Handmotorik
Die Handmotorik umfasst die koordinierten Bewegungen der Finger, der Mittelhand und des Handgelenks. Die Oppositionsbewegung (Daumen und andere Finger werden sich gegenübergestellt) ist dabei die wichtigste Bewegung der menschlichen Hand.
| Altersbereich | Entwicklung |
|---|---|
| ~0 bis 1 Monate | - Greifreflex (unwillkürliches Greifen bei Berührung der Handinnenfläche). - Die Hände sind meist zur Faust geballt. |
| ~2 Monate | - Die Hände beginnen sich zu öffnen. - Erste visuelle Kontrolle über Hände. |
| ~3 Monate | - Erste gezielte Bewegungen zur Hand-Mund-Koordination. - Schlagen nach Objekten. |
| ~4 Monate | - Das Kind streckt die Hand zu Objekten aus, öffnet die Hand, ergreift den Gegenstand und führt diesen zum Mund. - Die Hände berühren sich an der Körpermittellinie und spielen miteinander. |
| ~5 Monate | - Weiter entfernte Gegenstände können mit ausgestrecktem Arm gegriffen werden. |
| ~6 Monate | - Gegenstände werden gezielt und mit der ganzen Handfläche und gestrecktem Daumen gegriffen (palmares Greifen im „Faustgriff“). - Gegenstände werden von einer Hand in die andere Hand übergeben. - Hand- und Armbewegungen von anderen Personen werden imitiert. |
| ~7 bis 8 Monate | - Kleine Gegenstände können im „Scherengriff“ gegriffen werden. - Zwei Gegenstände können gleichzeitig mit zwei Händen gehalten werden. - Gegenstände werden absichtlich gegeneinandergeschlagen. |
| ~9 bis 10 Monate | - Gegenstände werden absichtlich fallen gelassen. - Erwerb des „Pinzettengriffs“. |
| ~11 bis 18 Monate | - Das Kind kann einen Stift halten und damit kritzeln. - Kisten und Regale werden aus- und eingeräumt. - Tasten wird z.B. zur Oberflächenunterscheidung angewandt. - Stapeln von Objekten und gezieltes Loslassen ist möglich. - Objekte werden kombiniert (z.B. Teddy in Wagen legen). |
| ~19 bis 24 Monate | - Kritzeln mit mehr Druck und veränderter Stifthaltung. - Türme bis fünf Klötzchen werden gebaut. - Erstes Auffädeln großer Perlen. - Kipp- und Schüttbewegungen. - Rotationsbewegungen der Hand (z.B. zum Öffnen von Verschlüssen). |
| bis 36 Monate | - Das Kind hat die wesentlichen Muster der Handmotorik erreicht. |
(vgl. Rosenkötter 2013; Largo 2017)
Prinzipien der Entwicklung von Motorik und Bewegung
Differenzierung
- Erlernte Bewegungen werden im Laufe der kindlichen Entwicklung weiter ausdifferenziert.
Zentralisierung
- Frühkindliche Reflexe werden in Reaktionsmuster integriert und zu koordinierten Bewegungsmustern verbunden.
- Motorische Handlungen sind als Bewegungsmuster zentral abrufbar und werden zentral gesteuert.
Aufrichtung gegen die Schwerkraft
- Die Aufrichtung gegen die Schwerkraft nimmt vom Liegen mit breiter Auflagefläche des ganzen Körpers, bis hin zum Stehen mit kleiner Standfläche immer weiter zu.
Entwicklungsrichtungen der Motorik und Bewegung
- Cephalo-caudal (vom Kopf zu den Füßen)
- Proximo-distal (von der Körpermitte zu den Extremitäten)
- Aber: eine Entwicklungsrichtung kann sich nicht ohne die entsprechende gegenläufige Anregung vollziehen.
Wechsel von Haltungs- und Bewegungsphasen
- Symmetrische und asymmetrische Haltungs- und Bewegungsphasen gehen ineinander über.
- Symmetrie sorgt für Statik, Sicherheit und Stabilität.
- Asymmetrie ermöglicht Gewichtsverlagerungen, Beweglichkeit und Mobilität.
Inter- und intraindividuelle Variabilität
- Die motorische Entwicklung ist von Kind zu Kind zeitlich sehr unterschiedlich.
- Auch der individuelle Entwicklungsverlauf verläuft nicht konstant. Unterschiedliche Reife- und Entwicklungsphasen greifen ineinander und beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Stemme et al. 2012; Largo 2017; Leyendecker 2005).
Literatur
Largo, R. (2017). Babyjahre. Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren. München: Piper.
Leyendecker, C. (2005). Motorische Behinderungen. Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten. Stuttgart: Kohlhammer.
Michaelis, R., Kahle, H. & Michaelis U.S. (1993). Variabilität in der frühen motorischen Entwicklung. In: Kindheit und Entwicklung 2, 215-221.
Michaelis, R., Berger, R., Nennstiel-Ratzel, U. & Krägeloh-Mann, I. (2013). Validierte und teilvalidierte Grenzsteine der Entwicklung. Ein Entwicklungsscreening für die ersten 6 Lebensjahre. In: Monatszeitschrift Kinderheilkunde 161, 898-910.
Pickler, E. & Tardos, A. (2018). Laßt mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen. München: Pflaum.
Rosenröter, H. (2013). Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung. Stuttgart: Kohlhammer.
Stemme, G., Eickstedt, D. von & Laage-Gaupp, A. (2012). Die frühkindliche Bewegungsentwicklung. Vielfalt und Besonderheiten. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg