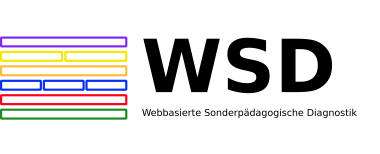Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Modellierungstechniken
Zitiervorschlag: Rauner, R. (2025). „Modellierungstechniken“. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:didaktisierung:lehrer_innensprache:modellierung, CC BY-SA 4.0
Modellierungstechniken lassen sich grundsätzlich in zwei Formen unterscheiden:
- Modellierungstechniken, die den kindlichen Äußerungen vorausgehen
- Modellierungstechniken, die den kinlichen Äußerungen nachfolgen
Im Folgenden werden diese beschrieben und anhand von Beispielen verdeutlicht.
Modellierungstechniken, die den kindlichen Äußerungen vorausgehen
Präsentation:
Die Lehrperson präsentiert eine Zielstruktur z. B aus einem Handlungskontexts heraus, der eine Vermutung oder eine Feststellung nach sich zieht.
Beispiel: Wenn ich ganz viel Zeit hätte, dann würde ich…
Das Sprachmuster kann dann von mehreren Schüler:innen aufgegriffen, nachgesprochen werden. Als optische Sprachstütze bei schwierigen Zielformen bietet sich hier auch eine Satzmustervorgabe an, die im Klassenzimmer visuell permanent verfügbar ist. So kann die Lehrperson immer wieder darauf hinweisen.
Parallelsprechen:
Unter Parallelsprechen wird das Versprachlichen von Intentionen, Handlungen und Wünschen verstanden.
Beispiel (Kaufladenspiel): Du willst einen grünen Apfel. Willst du auch noch einen roten Buntstift, ich habe noch einen blauen Bagger …
Beispiel (Mathematikunterricht): Die Lehrperson spricht parallel zur Vorgehensweise bei einer Rechenoperation.
Linguistische Markierung:
Situationsmerkmale, auf die die Schüler:innen gerade achten, werden versprachlicht, um die Zielstruktur in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken.
Beispiel (Subjekt Verb Inversion): Zuerst kann ich…, dann können wir… anschließend kannst du…
Alternativfragen: Zwei Modelle einer Struktur werden den Schüler:innen angeboten. „Gehören die Schuhe ins Bett oder ins Regal?„
Modellierungstechniken, die den kindlichen Äußerungen nachfolgen
Expansion:
Nicht korrekte Äußerungen von Schüler:innen werden unter Einbau der Zielstruktur vervollständigt. Auch Aussprachefehler können so richtiggestellt werden.
Beispiel: Schüler: „Die Frau gleich kommen:“ Lehrperson: „Ja, die Frau kommt gleich.“
Umformung:
Schüler:innenäußerungen werden unter Einbau der sprachlichen Zielstruktur verändert.
Schülerin: „Wir Autos nehmen!“ Lehrperson: Gut, dann nehmen wir die Autos! Nehmen wir auch…?„
Korrektives Feedback:
Fehlerhafte Äußerungen von Schüler:nnen werden in der Kommunikation von der Lehrperson mit berichtigter Zielstruktur angeboten.
Beispiel: Schüler: „Da ist die Sere.“ L: „Danke für die Schere.“
Modellierte Selbstkorrektur:
Fehler des Kindes wird von der Lehrperson aufgegriffen und bei sich selbst korrigiert.
Beispiel: Schüler: „Wir muss uns beeilen.„ Lehrperson: „Stimmt, wir muss ….. ach falsch: Wir müssen uns beeilen.“
Extension:
Äußerungen von Schüler:innen werden durch die Lehrperson semantisch weitergeführt.
Beispiel: „Der Hund da bellen .“ L: „Der Hund bellt, aber er beißt nicht.“
Literatur
Dannenbauer, F. M.: Grammatik. In: Baumgartner, S. & Füssenich, I. (Hrsg.): Sprachtherapie mit Kindern. München: Reinhardt, 5. Auflage 2002, S. 142-161.
Heinzl, C & Rodrian, B. (2019): Basistext „Modellieren“ als Methode zur Sprachförderung. Abrufbar unter: https://www.idl.lehrerbildung-at-lmu.mzl.uni-muenchen.de/foerderschwerpunkte/sprache/unterrichtsprinzipien/modellieren_basistext.pdf
Reber K. & Schönauer-Schneider W. (2014). Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts. München: Ernst Reinhardt-Verlag
Schönauer-Schneider W. (2014). Bausteine zur Lehrersprache. Praktische Umsetzungsmöglichkeiten. In: Praxis Sprache 2/2014, S.119-122.
Stecher, M., Rauner, R. (2019). Unterrichtsqualität im Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation. Heidelberg: Median-Verlag
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg