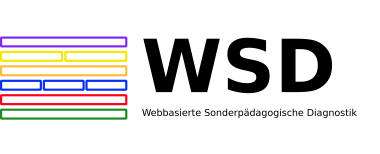Inhaltsverzeichnis
Dialogisches Bilderbuchbetrachten/Vorlesen
Zitiervorschlag: Rauner, R. (2022). „Dialogisches Bilderbuchbetrachten/Vorlesen“. Abgerufen von URL: https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:didaktisierung:dialogisches_vorlesen, CC BY-SA 4.0
Literale Erfahrungen im Sinne von Literacy ermöglichen Kindern die Erweiterung ihres Wortschatzes, ihrer Ausdrucksmöglichkeiten und ihres Weltverständnisses. Gerade die dialogische Form der Bilderbuchbetrachtung/des Vorlesens eröffnet vielfältige Lernchancen: Das Bilderbuch bietet durch seinen Inhalt und durch seine Illustrationen eine Vielzahl an Gesprächsanlässen. Hierbei unterscheidet sich die das dialogische Vorlesen in verschiedenen Aspekten vom „klassischen“ Vorlesen (vgl. Alt 2013 in Anlehnung an Kraus 2005):
| Klassisches Vorlesen | Dialogisches Bilderbuchbetrachten/Vorlesen | |
|---|---|---|
| Struktur | mit einer größeren Gruppe möglich | in einer Kleingruppe mit höchstens vier Kindern |
| Erzähler:in/vorlesende Person | erzählt/liest vor; bleibt durchgehend gleich aktiv | stellt Fragen; setzt Impulse; unterbricht die Geschichte an geeigneten Stellen; greift Beiträge der Kinder auf |
| Kinder | hören zu; sind eher passiv | stellen zwischendurch Fragen; erzählen von eigenen Erfahrungen; Beiträge der Kinder sind ausdrücklich erwünscht |
Der Kern der dialogischen Bilderbuchbetrachtung/des dialogischen Vorlesens ist also nicht die reine Vermittlung der Geschichte, sondern vielmehr das Gespräch über die Geschichte. Im Gespräch über das betrachtete Buch/die vorgelesene Geschichte können die Kinder ihre eigenen Meinungen, Eindrücke und Assoziationen einbringen und Fragen stellen. Kinder können sich mit den Protagonist:innen ihrer Geschichten identifizieren oder auch nicht, gemeinsame Erfahrungen machen, diese auf ihre persönlichen Erfahrungen beziehen, Probleme lösen und Handlungsstrategien entwickeln (vgl. Seidel 2003). Das Buch ist also lediglich der „Aufhänger“ für die Fragen, Erzählungen, Ansichten und Vorstellungen der Kinder.
Wichtig ist, dass die Kinder aktiv am Geschehen teilnehmen, dass sie sich als erzählende und steuernde Personen erleben, dass die das Gefühl haben, ihre Gedanken auch aussprechen zu können und dass ihre Meinung immer gefragt ist – ohne Wertung und offensichtliche Korrektur. Je nach Alter und Entwicklungsstufe des Kindes und abhängig vom Inhalt des Buches können diese Prozesse sehr unterschiedlich und variationsreich ablaufen.
- Benennen der Illustrationen und der darauf abgebildeten Dinge und Situationen
- Beschreiben, umschreiben, erweitern
- Beziehungen zwischen einzelnen Protagonist:innen, zwischen Bildern und Text und später zwischen den einzelnen Kapiteln eines Buches herstellen
- Eigenen Lebens-, Umwelt und Kulturbezug herstellen
- Projizieren, vorausdenken, Geschichten weiterentwickeln
- Bilder, Text, Gefühle, Handlungen deuten und erklären können
Die:Der Vorlesende sollte beim dialogischen Bilderbuchbetrachten/Vorlesen folgende Aspekte beachten, damit dieses zu einem förderlichen Bildungsangebot im Kontext Sprache und Kommunikation werden kann (vgl. Seidel 2013 und Kappeler Suter et al 2017):
- Anpassung des eigenen Lese- und Sprechtempo an den Entwicklungsstand der Kinder
- Einplanen von ausreichend Zeit zum Zuhören und Verstehen
- Eingehen auf spontane Zwischenfragen der Kinder/Fragen an die Kinder zurückgeben
- Stellen von offenen Fragen, die zum Nachdenken anregen
- Einsetzen von korrektivem Feedback auf Kinderäußerungen zum Anbieten der korrekten Aussprache oder Syntax, ohne das Kind direkt auf Fehler hinzuweisen
- Aufgreifen von Ein- und Zweiwortäußerungen der Kinder und in ganze Sätze bringen, d.h. Vervollständigung von kindlichen Äußerungen
- Modifizierung kindlicher Äußerungen/auf eigene sprachliche Variationen achten
- Erklärung von Fremdwörtern, Wörtern aus der Bildungssprache, von selten vorkommenden Redewendungen und neuen Begriffe erklären
- Fragen der Kinder nach kausalen Zusammenhängen „Warum?“ immer beantworten
- Miteinbeziehen der Kinder z. B. auch durch das Umblättern der Seiten
- Pausen an ausgewählten Stellen setzen und die Kinder ergänzen oder weitererzählen lassen (z. B. bie Gedichten oder Büchern mit Reimen)
- Sprachliche Besonderheiten der Geschichte mitsprechen lassen, wie z.B. Formeln oder wiederkehrende Sätze
- Vermutungen der Kinder über den weiteren Verlauf der Geschichte, die anhand der Illustrationen versprachlicht werden, aufgreifen, bestätigen oder richtigstellen
- Vor dem Umblättern und am Ende Fragen nach dem Fortgang oder Ausgang der Geschichte stellen
- Fragen nach den persönlichen Interpretationen, Wahrnehmungen, Denkweisen oder den Gefühlen der Kinder
- Bei einem großen Erzählbedürfnis der Kinder einzelne Seiten des Buches in eigenen Worten wiedergeben, um Raum für Dialoge zu haben und trotzdem den Faden der Geschichte nicht zu verlieren
- Wiederholung wichtiger und spannender Textstellen
- Unterstützung des Vorleseprozesses durch nonverbale Aspekte (Gesten, Berührungen, Bewegungen)
Weiterführende Materialien
Unter https://projekt-readi.de sind Bilderbücher zu finden, die in Deutsch, Englisch, Türkisch oder Arabisch gelesen werden können. Außerdem können die Texte in Deutscher Gebärdensprache oder in Deutsch vorlesen werden lassen. Darüber hinaus werden Tipps zur Verfügung gestellt, wie mit Kindern über die Bücher gesprochen werden kann.
Literatur
Kappeler Suter, S. et al. für das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien (2017). Leitfaden Dialogisches Lesen. Villmergen: Sprüngli Druck AG
Kraus, K. (2005). Dialogisches Lesen – neue Wege der Sprachförderung in Kindergarten und Familie. In: Roux, Susanna (Hrsg.): PISA und die Folgen. Sprache und Sprachförderung im Kindergarten. Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 109-129
Seidel, M. (2008). Sprachliche Förderung durch Vorlesen- Dokumentation und Analyse gesprächszentrierter Vorlesesituationen mit Bilderbüchern mit spezifischem Sprachförderpotenzial. München: Deutsches Jugendinstitut e. V.
Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg